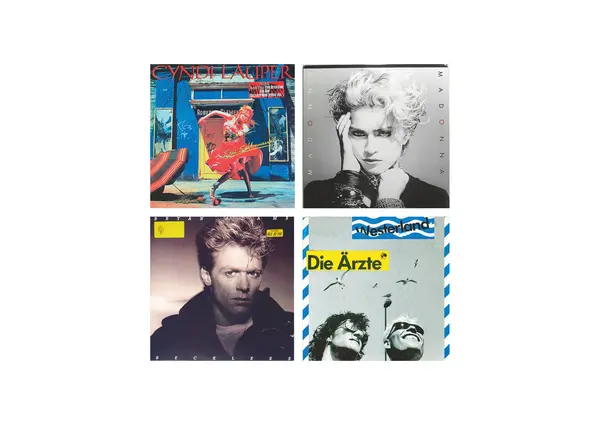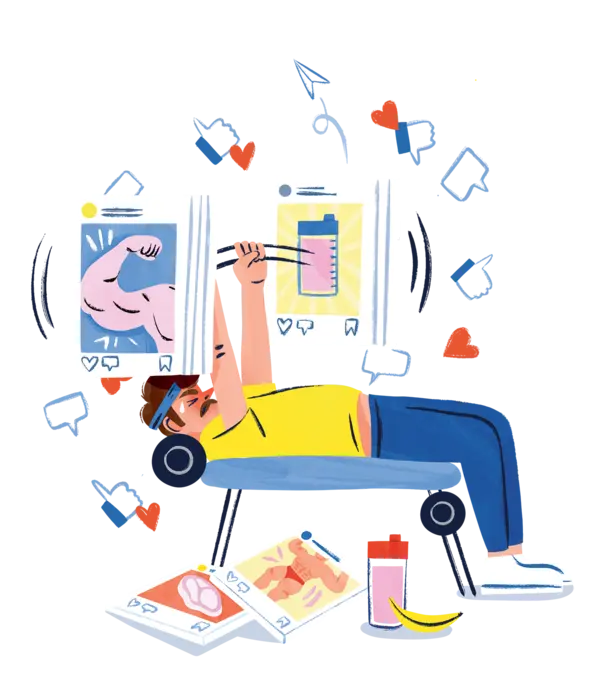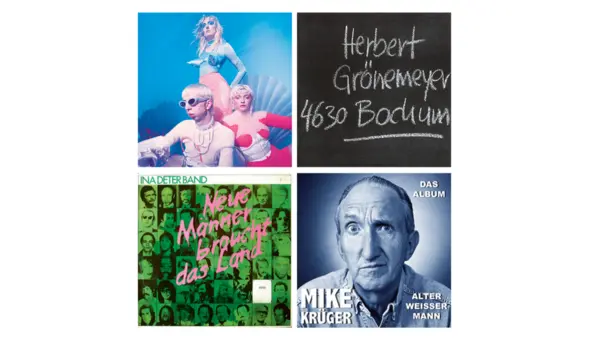Zwischen Burn-Out und Depression
Von psychischen Erkrankungen sind Männer anders betroffen als Frauen. Ein Blick auf Klischee und Wirklichkeit.

Sie erfahren, warum es wichtig ist, Belastungen frühzeitig zu erkennen, offen darüber zu sprechen und rechtzeitig Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Das weit verbreitete Klischee geht so: Ein Mann leidet jeden Tag unter Arbeitsstress. Er lässt sich nichts anmerken. Er spricht mit niemandem über seine wachsenden Belastungen, weder mit seiner Familie noch mit seinem Arbeitgeber. Statt rechtzeitig auf die Bremse zu treten, versucht er, immer noch leistungsfähiger zu werden. Bis er schließlich zusammenklappt. Dann geht nichts mehr. Diagnose: Burn-out.
Was stimmt daran? Schon mit dem Begriff heißt es: Aufpassen! „Burn-out ist keine Diagnose“, erläutert Dr. Thomas Kirchmeier, Chefarzt der Psychosomatischen Klinik in Bischofsgrün. „Der Fachbegriff für diese Krankheitsform lautet Neurasthenie. Dabei handelt es sich um ein Gefühl der chronischen Erschöpfung auf körperlicher und psychischer Ebene. Man kann sich nicht mehr entspannen, kommt nicht mehr herunter.“ Diese Symptomatik ist allerdings beileibe nicht auf Männer beschränkt, Frauen können genauso betroffen sein. Laut Daten der Krankenkasse Barmer weisen in der Bundesrepublik geschlechterübergreifend rund 37 Prozent der Menschen Burn-out-Symptome auf.
Bei Depressionen ist das anders. Von ihnen sind tatsächlich Frauen fast doppelt so häufig betroffen wie Männer: Laut Barmer leiden in Deutschland über 146 von 1.000 Frauen unter Depressionen. Bei den Männern sind es rund 82 Fälle je 1.000 Personen. Barmer weist darauf hin, dass eine Depression sich anhand von Symptomen diagnostizieren lässt, während der Burn-out nicht eindeutig definiert sei. Hier spiele der Grund fürs „Ausbrennen“ eine zentrale Rolle. Studien zeigen, dass es eine statistische Beziehung zwischen Burn-out und Depression gibt, aber beide gelten als eigenständige Konstrukte. Dennoch überschneiden sich die Symptome – etwa Antriebslosigkeit, Erschöpfung und Konzentrationsstörungen –, was in der Praxis häufig zu Fehldiagnosen führen kann. Häufig wird die Entstehung des Burn-out-Syndroms in mehreren Phasen der emotionalen Erschöpfung dargestellt. Im letzten Stadium des Prozesses liegt meist ebenfalls eine Depression vor.
Das Wort Depression ist aus dem Lateinischen abgeleitet und bedeutet so viel wie „niedergedrückt sein“, erklärt Dr. Kirchmeier. „Aber niedergedrückt oder traurig zu sein, heißt nicht zwangsläufig, dass man depressiv ist. Trauer hat eine Funktion. Weinen verarbeitet Belastung. Das ist bei Depressionen nicht der Fall. Bei depressiven Erkrankungen liegt oft Gefühllosigkeit vor, man ist wie taub und hat ein Gefühl der Leere.“ Hierbei entwickeln Männer oftmals eine andere Symptomatik als Frauen: „Depressionen bei Männern werden im ambulanten Versorgungssystem, etwa beim Hausarzt, häufig übersehen“, so Dr. Kirchmeier. Hier stehe insbesondere eine gereizte Stimmungslage und eine allgemein zunehmende Aggressivität im Vordergrund, auch als „kurze Zündschnur“ bezeichnet. „Dies wird nicht selten verkannt.“

„Wer zugibt, dass es ihm psychisch nicht gut geht, zeigt Schwäche.“
Dr. med. Thomas Kirchmeier, Chefarzt der Psychosomatischen Klinik in Bischofsgrün
Burn-out ist positiv besetzt
Dass der Burn-out eher mit Männern assoziiert wird, hat möglicherweise seinen Grund in einer gesellschaftlichen Zuschreibung: „Ein Burn-out bringt heute fast schon gesellschaftliche Achtung, deshalb wird dieses Wort vermutlich oft verwendet. Das wird positiv gesehen, ist aber völlig verkehrt“, erklärt Dr. Kirchmeier. Unter anderem kann es sich zu einem ernsthaften gesellschaftlichen Problem ausweiten.
Laut einer aktuellen Umfrage der Pronova Betriebskrankenkasse befürchten 61 Prozent der Deutschen, einen Burn-out infolge von Überlastung zu erleiden. Das sind elf Prozent mehr als vor der Coronapandemie im Jahr 2018, als dies nur jeder Zweite von sich sagte. Bei der Pronova hat die Zahl der Burn-out-Fälle 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent zugenommen.
Geschlechterunterschiede in der Häufigkeit und Ausprägung psychischer Belastungen existieren also, sie werden aber maßgeblich auch durch gesellschaftliche Rollenbilder beeinflusst. So auch von der Bereitschaft, Symptome zu berichten. Und die ist bei Männern aufgrund von tradierten Geschlechterrollen womöglich weniger stark ausgeprägt als bei Frauen. Hier mag an dem eingangs skizzierten Klischee etwas dran sein: In einer aktuellen Forsa-Umfrage geben 44 Prozent der Männer an, dass es ihnen schwerfällt, über Gefühle zu sprechen. Viele ziehen sich zurück und versuchen, Probleme allein zu bewältigen.
„Wer zugibt, es dass es ihm psychisch nicht gut geht, zeigt Schwäche. Das widerspricht dem traditionellen Männlichkeitsbild“, so Dr. Kirchmeier. Als Chefarzt in der Psychosomatik weiß er auch, dass es Männern außerhalb des Alltags, in dem sie glauben sich bewähren zu müssen, leichter fällt, sich zu öffnen. Darauf liegt auch der Fokus innerhalb einer Rehabilitation: In der Höhenklinik in Bischofsgrün wird Psychotherapie einzeln und in Gruppen angeboten, auch für spezielle Probleme wie Depressionen, Ängste oder Schmerzen. Die Patienten werden von einem festen Bezugstherapeutenteam betreut. Dazu gehören Stressmanagement, Stressbewältigungsmethoden und entspannende Verfahren wie Bewegungstherapie, Progressive Muskelentspannung oder Qigong. Dr. Kirchmeier ist überzeugt: „Eine Reha bietet eine Chance, eine gute Balance zwischen inneren und äußeren Anforderungen und Bedürfnissen zu entwickeln.“
Reha in Bischofsgrün
Die Höhenklinik in Bischofsgrün ist eine Rehaklinik der DRV Nordbayern. Sie ist auf Psychotherapie und Psychosomatische Medizin spezialisiert und verfolgt einen „multimodalen“ Ansatz. Das bedeutet, dass die Erkrankung von möglichst vielen verschiedenen Seiten betrachtet und analysiert wird. Denn meist handelt es bei psychosomatischen und psychotherapeutischen Problemstellungen um ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Entsprechend breit aufgestellt sind die Möglichkeiten der Behandlung: von der Gesprächstherapie über verhaltensorientierte Trainings bis hin zur körperlichen Stärkung und besseren Ernährung.